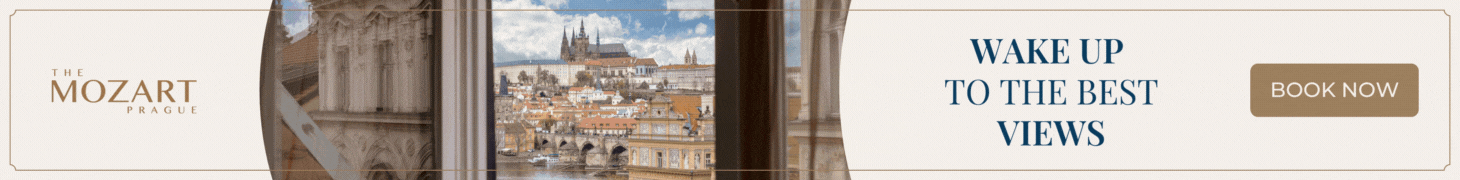Shakespeare sollte man an diesem Abend vergessen. Und Verdi gleich mit ihm. Gioachino Rossini und sein Librettist Francesco Maria Berio haben die berühmte Tragödie an einigen entscheidenden Stellen umarrangiert. In ihrem Otello stellt sich Desdemonas eigener Vater Elmiro einer Ehe zwischen seiner Tochter und dem triumphierenden, nordafrikanischen Feldherrn in den Weg. Aus politischen Gründen will er sie am Arm von Rodrigo sehen, dem Sohn des Dogen. Intrigant Jago, der bei Rossini statt des berühmten Taschentuchs einen Brief abfängt, taucht zwar auch auf, die Figur bleibt jedoch eine blasse Randfigur und befeuert lediglich Verdachtsfunken, die längst im eifersüchtigen Otello lodern.
Wenn die Oper Frankfurt Rossinis Otello als Eröffnungsstück der Saison zeigt, fügt sich diese Entscheidung in ein wiedererstarkendes Interesse an Rossinis Seria-Opern. Trotzdem dürfte das Stück beim heutigen Publikum noch nahezu unbekannt sein. Seine einstige Strahlkraft, die Rossinis eigenwilligen und innovativen Otello zur musikalischen Sensation der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts torpedierte, hat das Werk längst noch nicht wiedererlangt.
Einen erneuten Popularitätsschub dürfte auch die Besetzung erschweren. Rossini komponierte mit Otello, Rodrigo und Jago drei Tenorhauptrollen. Ungemein schwer sind die noch dazu, was in Frankfurt leider deutlich hörbar blieb. Vor allem Enea Scala in der Titelpartie, die einen immensen Ambitus und zugleich eine enorme Flexibilität für die zahlreich komponierten Koloraturen erfordert, mühte sich von Beginn an mit metallischer Enge durch den Abend. In mittlerer Lage war zwar deutlich, dass der Italiener über einen imposanten Stimmapparat verfügt, doch hätte er sich damit eher für Verdi als Rossini qualifiziert. Vor allem in der Höhe half ihm seine Stimmwucht wenig. Auch Theo Lebow als Jago beeindruckte eher durch überengagiert schauspielerische denn stimmliche Leistungen. Wie ein Wahnsinniger wälzt und springt sich die Schlange über die Bühne, sodass ihm fürs Singen kaum Raum blieb.
Einzig Jack Swanson sang den Rodrigo so schön, dass man Mitleid bekommen mag mit Otellos Konkurrenten. Sowohl den herausfordernden Umfang als auch die vielen waghalsig schnellen Sprünge vermochte der junge Amerikaner zum allergrößten Teil bravourös, ja beinahe leichtfüßig zu bewältigen. Vollkommen zurecht war seine Arie im zweiten Akt („Che ascolto? ahimè, che dici?“ – „Ah, come mai non senti“) dem Frankfurter Publikum einen anhaltenden Zwischenapplaus wert. Elegant präsentierten sich auch Hans-Jürgen Lazar als Doge und berührend vor allem Michael Petrucceli als Lucio, ein Gondoliere (in Frankfurt: Arzt) mit der berühmten melancholischen Kanzone im letzten Akt, die Franz Liszt in seinem Klavierzyklus Venezia e Napoli verarbeitete. Solide und überaus wendig in tiefer Lage stach auch Ensemble-Mitglied Thomas Faulkner als Desdemonas Vater Elmiro in der einzigen Basspartie hervor.
Obwohl die Produktion bereits vor drei Jahren am Theater an der Wien gezeigt wurde, geht die Besetzung weitgehend auf die Kappe der Oper Frankfurt. Allein Nino Machaidze war bereits in der Ursprungsfassung als Desdemona zu hören und sprang auch in Frankfurt kurzfristig für die erkrankte Karolina Makuła ein. Machaidzes warmer und trotzdem dramatischer Sopran fügte sich hervorragend in den tenorlastigen Gesamtklang und wurde nur noch überstrahlt von Kelsey Lauritano als Desdemonas Schwester Emilia, die der eigentlich eindimensional komischen, wenn auch in Frankfurt zur Intrigantin mit eigenen Motiven ausgeweiteten Rolle in Spiel und Klang eine herausragende charakterliche Tiefe verlieh.
Ob sich die Oper Frankfurt mit der Übernahme der Wiener Inszenierung von Damiano Michieletto einen Gefallen getan hat, bleibt vor allem im dritten Akt fraglich. Der Regisseur transportiert Rossinis Otello als Eifersuchts-Tragödie unter international agierenden Geschäftsmännern in unsere Gegenwart. Die Herren schreiten in schwarzen und grauen Anzügen über die marmorgetäfelte Bühne, die Damen in eleganten Etuikleidern. Nur Otello hat man zur Sicherheit einen Turban aufgesetzt. Diese Idee mag in ihrer Anlage einleuchten. Obwohl die geschäftlichen Erfolge von Otello auch in der westeuropäischen Welt angesehen werden, die eigene Tochter möchte man mit dem muslimischen Kollegen dann doch nicht verheiraten. Einige scharf konservative Spitzen gegen Otellos Glauben könnte man der Inszenierung nachsehen. Nach seiner siegreichen Heimkehr aus der Türkenschlacht beziehungsweise von einem erfolgreichen Business-Deal hüllt Otello seine Geliebte Desdemona, mit der er zu dieser Zeit bereits heimliche verheiratet ist, unter lautstarker Belustigung des Frankfurter Publikums in einen Niqab. Im dritten Akt zerfasert die Inszenierung jedoch zunehmend. Als der Eifersuchtsstreit zwischen Otello und Desdemona eskaliert, lässt Michieletto die zu Unrecht der Untreue Beschuldigte selbst zur Waffe greifen. Dieser Suizid erschließt sich dramaturgisch jedoch nicht, hat er doch vielmehr den leisen Beigeschmack eines klischeedurchtränkten Ehrenmords.
Überzeugend gelangen die feinen lyrischen Nuancierungen Rossinis vor allem dem Frankfurter Opern- und Museumsorchester unter der Leitung von Sesto Quatrini. Filigran ließ er die fantastischen Holz- und Blechbläsersoli aus dem Orchester hervortreten und verstand es ohnehin aufs Feinste, seinen Klangkörper agil und vielschichtig zu führen. Dass es sich auf deutschen Opernbühnen mittlerweile durchgesetzt hat, kein orchestrales Vor- und Zwischenspiel mehr für sich wirken zu lassen, sondern permanent visuelle Parallelunterhaltung auf der Bühne zu bieten, beweist sich jedoch nur ein weiteres Mal in dieser Inszenierung. Schade!