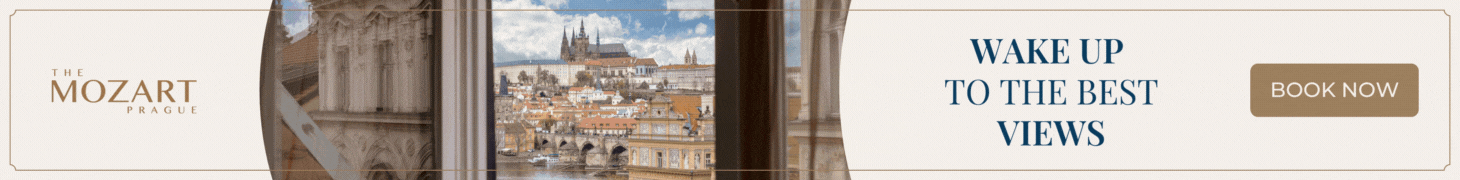Mit Spannung erwartet und medial groß angekündigt wurde seit Wochen die eröffnende Madama Butterfly, als beinahe spannender erwies sich jedoch der zweite Abend der Saison an der Wiener Staatsoper. Denn hier kehrten gleich zwei Herren symbolträchtig zurück: einerseits Harry Kupfer, dessen Inszenierung von Richard Strauss’ Elektra eigentlich vor fünf Jahren durch eine Neuinszenierung ersetzt wurde und andererseits Franz Welser-Möst, der seinen Posten als Generalmusikdirektor 2014 aufgab, da er mit dem damaligen Direktor Meyer nicht auf einen grünen Zweig kam. Der „Neue“ im Haus am Ring, Bogdan Roščić, wollte mit diesem Abend wohl ein Zeichen setzen – sowohl der Inszenierung von Kupfer als auch dem Dirigat von Welser-Möst wurde vom Wiener Stammpublikum in den vergangenen Jahren nämlich ausgiebig nachgetrauert.
Von Bravo-Rufen und stürmischem Applaus begleitet trat der heimgekehrte Dirigent ans Pult und demonstrierte in Folge 105 Minuten lang, warum sein Dirigat dieser Oper vor wenigen Wochen in Salzburg so gefeiert wurde. Den Spannungsbogen baute Welser-Möst konsequent vom ersten bis zum letzten Takt auf und konnte sich dabei stets auf „seine“ Philharmoniker, die in diesem Haus streng genommen natürlich als Orchester der Wiener Staatsoper spielen, verlassen. Selten hat man in einer Elektra so zart schwelgende Passagen gehört, wie in dieser Interpretation; die gemeinsame Szene von Elektra und Orest gestalteten Orchester und Dirigent in lieblichen, hoffnungsvollen Klangfarben und vermittelten so all die Emotionen der Figuren innerhalb weniger Takte. Ekstatisch und aufbrausend spielten sich die Musiker hingegen in einen regelrechten Rausch, wenn es darum ging, Elektras Hass eine Stimme zu verleihen. Nicht immer gelang dabei allerdings die Balance zwischen Bühne und Graben ganz ausgewogen, zumindest ergab sich im Parkett dieser Eindruck. Beeindruckend war den ganzen Abend über die Vielschichtigkeit der Interpretation, jeder Ebene der Partitur wurde Raum gegeben und jedes Brodeln der Streicher und jeder Akzent der Bläser verdeutlichte einen Charakterzug der Figuren. Kurzum, zu hören war eine pure Machtdemonstration von Dirigent und Orchester.
So sehr sie sich auch bemühten, ganz konnten die Sänger an diesem Abend mit dem extrem hohen Niveau aus dem Graben nicht durchgehend mithalten, obwohl sie durchwegs ausgezeichnete Leistungen ablieferten. Ricarda Merbeth gestaltete eine resolute Elektra, der die menschlichen Regungen in den zarteren Passagen – etwa der Szene mit Orest – besser in der Kehle lagen, als die hochdramatischen Rachegelüste im Fortissimo. Dass bei einer solch fordernden Partie nicht immer jeder Ton ganz lupenrein daherkam, darüber konnte man in Anbetracht der stimmigen Interpretation aber hinwegsehen. Beklemmend nonchalant und voll Kälte im Timbre trat sie Klytämnestra gegenüber, mit süßlichen Nuancen in der Stimme versuchte sie Chrysothemis zur gemeinsamen Bluttat zu überreden und in der Schlussszene stellte Merbeth Elektras euphorischen Wahn stimmlich und darstellerisch mitreißend dar. Als nicht minder verzweifelt als Elektra, wenn auch aus anderen Gründen, legte Camilla Nylund die Chrysothemis an. Mit einnehmender Bühnenpräsenz, lyrisch gestalteten Bögen und ergreifenden stimmlichen Ausbrüchen verlieh sie der Figur Glaubwürdigkeit fernab von der Schablonenhaftigkeit, die diesen Charakter oft begleitet. Wie bereits im Sommer in Salzburg stand auch an diesem Abend Derek Welton als Orest auf der Bühne und ließ seinen elegant timbrierten Bassbariton sonor durch sein Staatsoperndebüt strömen. Positiv fiel außerdem die hohe Wortdeutlichkeit des Australiers auf, wodurch er Musik und Text zu einer stimmigen Gesamtheit verbinden konnte. Die Stimme von Doris Soffel, die nach jahrzehntelanger Abwesenheit wieder im Haus am Ring zu hören war, hat zweifellos schon bessere Zeiten erlebt. Wie sie allerdings die Rolle gestaltete, die feinen Nuancen zwischen Größenwahn und Verzweiflung, zwischen Machtlust und Angst interpretierte, das war großes Kino. Rollendeckend schnarrend absolvierte Jörg Schneider den undankbaren und kurzen Auftritt des Aegisth; auch die übrigen kleinen Rollen waren durchwegs gut besetzt, wobei insbesondere Vera-Lotte Boecker als Fünfte Magd mit elegant strömendem Sopran positiv hervorstach.
Die Inszenierung von Harry Kupfer stellt die Figur des ermordeten Agamemnon imposant ins Zentrum; seine Statue wird allerdings nur teilweise gestürzt und die Seile der versuchten Demontage hängen noch herab. Durch das Bühnenbild und insbesondere auch durch die Beleuchtung ist die Inszenierung optisch ebenso eindrücklich wie schlicht. Warum jedoch durch die Kostüme ein buntes Potpourri von Mumien über Soldaten bis hin zu an Endzeit-Fantasy erinnernde Figuren entstehen muss, erschließt sich mir nicht. Packend ist das Schlussbild, wenn Orest als neuer Herrscher bejubelt wird und Elektra sich in den Seilen erhängt, da sie erkennt, dass sich an der grausamen Welt nichts ändern wird. Diese Interpretation spießt sich allerdings mit den eigentlichen Motiven von Elektra, die doch mehr von persönlicher Rache als von Diktatur-Kritik angetrieben wird. Stimmiger als die dadurch ersetzte Inszenierung von Uwe-Eric Laufenberg ist diese Produktion aber in jedem Fall. So ganz wurde dann beim Schlussapplaus übrigens nicht klar, wem bzw. was hier mehr zugejubelt wurde: der konkreten Vorstellung, der Rückkehr einer beliebten Inszenierung oder der Symbolkraft, die von der Heimholung zweier Publikumslieblinge ausging.