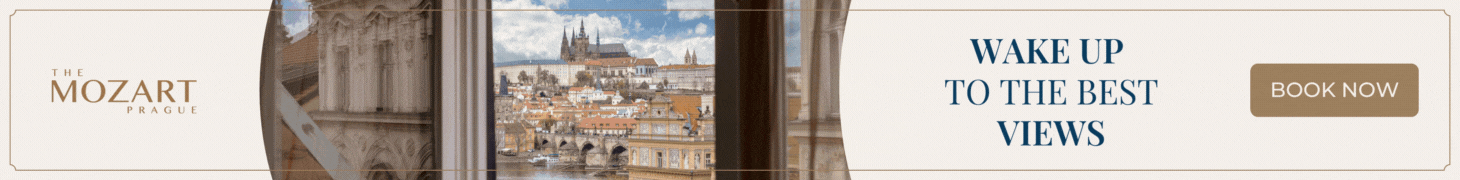„Plus ultra” (Immer weiter) lautete das Regierungsmotto von Karl V. Seit vergangenem Sonntag gilt dieser Leitspruch wohl auch für die Bayerische Staatsoper, denn in der Neuinszenierung von Ernst Kreneks Zwölftonoper Karl V. wird unter der Leitung von Carlus Padrissa nicht nur eine Grenze überschritten.
Auf der Bühne spritzt das Wasser, meterhoch türmen sich Spiegelgewölbe, dazwischen hängen marionettengleich nackte Menschenmassen, Videoprojektionen im Hintergrund, etwas Pyrotechnik hier und da, die Solisten staksen mit Gummistiefeln und bedruckten Neoprenkostümen herum und immer wieder kapert das Ensemble auch den Zuschauerraum selbst.
Was nach einem knallharten Konzept klingt, um auch wirklich jedem konservativen Operngänger einen Buh-Ruf zu entlocken, entpuppt sich überraschenderweise als abwechslungsreiche und gefällige Inszenierung. Das liegt sicherlich an der fabelhaften Besetzung, aber wahrscheinlich auch an der Entscheidung, die Inszenierung nicht zu nah am historischen Stoff des Stückes anzulehnen und auch auf aktualitätsbezogene politische Interpretationen zu verzichten.
Wenn der Chor der Deutschen im zweiten Teil des Bühnenstücks skandiert, „Wir aber wollen Deutsche sein, nicht Weltbürger“, dann fehlen die PEGIDA-Plakate. Das alles wäre möglich gewesen, denn schlussendlich reflektiert das Stück den Lebensabend von Kaiser Karl V. Einst baute er ein Weltreich auf, welches am Ende jedoch wegen zu vieler nationaler Interessen auseinander fiel und er sich ins Kloster zurückzog. Hier spricht er mit seinem Beichtvater bruchstückhaft über die Fehler seines bewegten Lebens.
Krenek bediente sich Anfang der 1930er mit der Aufnahme dieses Stoffs einer subtilen Parabel. In Deutschland erstarkten die nationalistischen Tendenzen, die gleichermaßen das liberale Europa gefährdeten. Aber auch die Waffen-SS lässt Padrissa an diesem Abend nicht aufmarschieren. Gleichwohl wird der Zuschauer immer wieder mit der scheiternden europäischen Idee konfrontiert, etwa wenn der Mob über das Publikum klettert oder Luther seine Thesen aus der ersten Zuschauerreihe proklamiert.
Im Einklang mit dieser Symbolik reduziert sich die Bühne selbst als ein großer Spiegel, der Scheinwerferlicht und Videoprojektionen geschickt und variabel leitet. Ist es ein Spiegel der Selbstreflektion? Einer, der Ideen gnadenlos abschmettert? Ein Spiegelkabinett, in dem sich der scheiternde Karl V. verläuft? Selbst das Bühnenparkett wird – vielleicht etwas zu effekthascherisch – mit Wasser geflutet, um der Reflexion eine weitere Dimension zu geben. Warum, bleibt schlussendlich offen, wenngleich der so geschaffene abstrakte Raum, auch für sich selbst stehen kann.
Nicht zuletzt deswegen, weil ihn die katalanischen Theatergruppe La Fura dels Baus, nicht ganz überraschend, durch Akrobatikskultpuren füllt. Mal wendet sich die gesichtslose Menschenmasse zum Gefängnis für den französischem König und mal zur Weltkugel, die Karl langsam entgleitet. Teilweise bewegt sich im mittleren Bühnenraum jedoch so viel, dass der Fokus auf die Solisten im Vordergrund beinahe vollständig verloren geht.
Das dies trotzdem nicht geschah, lag wohl einzig und allein an Bo Skovhus, der mit überzeugender, vokaler Präsenz, textklar und bis zur letzten Note authentisch die Titelrolle vortrug, auch wenn gegen Ende dieser nervenzermürbenden Partie die Kondition des Dänen etwas nach ließ.
Ihm gegenüber stand Wolfgang Ablinger-Sperrhacke, der bei seinem weinerlich-überheblichen Widersacher Franz I. nicht minder eindrückliche Akzente setzte. Hervorragend besetzt waren auch die weiblichen Nebenrollen an diesem Abend. Okka von der Damerau punktete, man möchte fast sagen wie immer, als Mutter Karls mit sinnlichem, rundem Wohlklang. Anne Schwanewilms blieb währenddessen als seine Frau Isabella mit himmlisch entrücktem Sopran genauso nachhaltig in Erinnerung, wie Gun-Brit Barkmins starke Interpretation von Karls Schwester Eleonore.
Ob es eine gute Entscheidung ist, die vielen Textpassagen mikrofonverstärkt und deutlich nachhallend in den Zuschauerraum zu tragen, kann in Frage gestellt werden. Nicht nur der junge Schauspieler Janus Torp als der Beichtvater Juan de Regla wirkte so auffallend flach und ganz ohne Dramatik. Die hervorragende Akustik der Bayerischen Staatsoper hätte sicherlich andere Lösungen geboten, die auch mehr klangliche Harmonie zwischen den einzelnen Szenen und Passagen hätte herstellen können.
Ungeachtet dessen kitzelte Dirgent Erik Nielsen aus dem Bayerischen Staatsorchester und dem strengen Korsett der Zwölftonmusik farbig brillante Szenen heraus. Angenehm klar und ausdifferenziert schillerte Kreneks anspruchsvolles Werk so durchaus bekömmlich und voller Leben. Die monumentalen Akzente setzte dabei der Chor unter Leitung von Stellario Fagone. Wer eine spröde Aufführung erwartet hatte, wurde eines Besseren belehrt.
Trotz der facettenreichen Neuinszenierung, in der das gesamte Ensemble wie ein Uhrwerk schnurrt, bleiben am Ende des gut zweieinhalbstündigen Bühnenwerkes gemischte Gefühle im Raum. Vielleicht war ein bisschen zu viel Zirkus und zu wenig Oper mit dabei. Die Handlung, so es überhaupt eine gibt, gerät fast vollständig in den Hintergrund. Aber es muss ebenso neidlos anerkannt werden, dass Kreneks sperriges Werk wohl selten so eingängig und unterhaltsam aufgeführt wurde. Immer weiter (so).