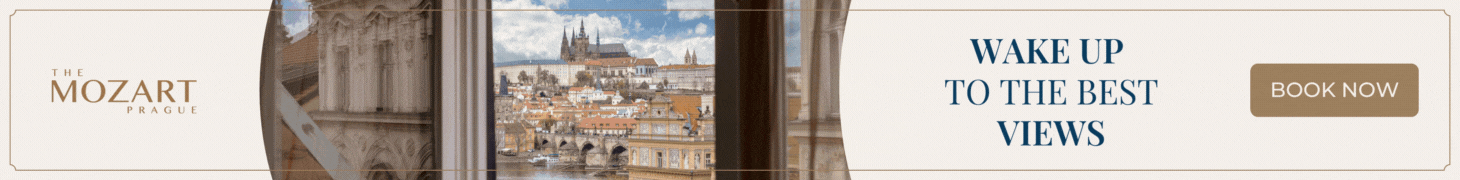Rossini-Freunde freuen sich grundsätzlich darüber, dass ihnen das Theater an der Wien in jeder Saison ein Werk des Meisters aus Pesaro serviert. Viel haben sie dabei schon gelacht (Le comte Ory, Il turco in Italia…), sich über manche Inszenierung aber auch gewundert (Tancredi, La donna del lago). Nun, zu lachen gibt’s bei der 1815 uraufgeführten Elisabetta, regina d‘Inghilterra stoffgemäß nichts...
Vielmehr herrscht Erstaunen – hauptsächlich über Regisseurin Amélie Niermeyers Versuch, den Abend mit einer einzigen Idee zu füllen. Sie stellt die berühmten Krinolinen-Kleider der historischen Elizabeth I. auf Rollen und lässt die Königin, die als Privatperson schwarze Hose und weiße Bluse trägt, durch einen raffinierten Klappmechanismus von hinten in die Staatsgewänder ein- und austreten (gediegene Kostüme: Kirsten Dephoff). Als Symbol von Macht und Präsenz nutzt sich diese Idee aber im Laufe des Abends ab, so wie das häufig passiert, wenn man Effekt gegen Sinnhaftigkeit auszuspielen versucht: Eine Königin käme nie auf die Idee, ihre abgelegten Gewänder in Reichweite des gemeinen Volkes zu lassen, und schon gar nicht ließe sie eine Anprobe durch ein paar männliche Chorsänger zu. Dass sie wie eine Flipperkugel zwischen ihren Bühnenpartnern hin- und her flitzt, statt königlich flitzen zu lassen, ist ein weiteres Beispiel dafür.
Lobenswert ist die handwerklich solide ausgearbeitete Personenregie, die sich speziell am Psychogramm der Titelpartie zeigt. Auch die Optik dieser Inszenierung ist gefällig, wiewohl man sich an der aktuell modernen Bühnenarchitektur schon ziemlich sattgesehen hat. Hohe, die Räume verengende und erweiternde Bühnenprospekte gab es schon zur Genüge, auch wenn jene von Bühnenbildner Alexander Müller-Elmau zumindest Witz haben: Für einen Historienschinken ist es nicht verkehrt, wenn der Hintergrund entfernt an alte lederne Bucheinbände erinnert.
Apropos historisch: Mit Tatsachen hat die Handlung von Elisabetta wenig zu tun; in erster Linie illustriert sie das Sprichwort „Wer anderen eine Grube gräbt…“ mit elisabethanischem Flair: Der eifersüchtige Norfolc verrät seiner angebeteten Königin, dass sein Freund und Kriegsheld Leicester (den wiederum die Königin verehrt) heimlich Mary Stuarts Tochter Matilde geheiratet hat. Da Elisabetta den Hochverräter Leicester nicht lieben darf, flüchtet sie sich in ihre Rolle als Königin.
Das Programmheft erwähnt 27 musikhistorisch gezählte Fälle von Recycling früheren Rossini-Materials (darunter die Ouvertüre aus Aureliano in Palmira, die später im Barbiere zum Welthit wurde), dennoch gilt Elisabetta insofern als richtungsweisend, als sie Rossinis erstes Engagement in Neapel war, wo die Opernpraxis aufgrund der politischen Situation französisch geprägt war. Diesem Einfluss konnte sich der Norditaliener nicht entziehen: Auf das Cembalo wurde zugunsten orchestrierter Rezitative verzichtet, der Chor erfuhr eine Aufwertung, während die Sänger in ihrer Selbstdarstellung durch genauere Vorgaben für Koloraturen beschnitten wurden. Nicht zuletzt reduzierte sich die Anzahl der Nummern durch Einbettung in eine breiter angelegte musikalische Struktur, welche in späteren Werken, etwa La donna del lago, ihre Vollendung fand. Dennoch bleibt das Werk durch den Widerspruch von ernster Handlung und heiterer Musik schwer vermittelbar.
Erfreulicherweise ist es im Theater an der Wien anforderungsgerecht besetzt. In der Titelpartie wusste sich Alexandra Deshorties mit großer Geste und Emotion in Szene zu setzen. Stimmlich überzeugte diese Sopranistin mit einer seltenen Kombination aus Flexibilität und Größe, in der Höhe war die Attacke aber manchmal zu viel des Guten. Als Matilde ließ Ilse Eerens saubere Koloraturen hören, in der kleinen Hosenrolle des Enrico gefiel Natalia Kawalek.
Da der pragmatische Rossini seine Arbeit nach den verfügbaren Sängerinnen und Sängern ausrichtete, gibt es in Elisabetta weder Bariton noch Bass, was den düsteren Stoff ziemlich konterkariert, doch einen eigenen Reiz entwickelt: Barry Banks verfügte neben Höhensicherheit über ein leicht nasales Rossini-Timbre, mit dem sich Norfolcs Eifersucht auf den Helden Leicester ausgezeichnet von der Seele raunzen ließ. Dass er in dieser Inszenierung eine buchstäblich schräge Frisur hat, passt zur Rolle.
Weniger Glück mit der Ausstattung hatte Norman Reinhardt, der in karierten Hosen das Objekt der Begierde geben muss. Dennoch war seine Leistung als Leicester bestechend; er überzeugte mit Schmelz und Durchschlagskraft und gestaltete seine Partie mit großer Musikalität. Das von einem hohen C gekrönte Duett der beiden Tenöre im zweiten Akt war, von Elisabettas Schlussgesang abgesehen, der Höhepunkt der Oper. Als Guglielmo ist Erik Årman Elisabettas Garderobier und verlässlicher Mann fürs Grobe.
Grob ging es auch im Graben zu, wo Jean-Christophe Spinosi und sein (Originalklang-)Ensemble Matheus die bekannte Ouvertüre im Stil des französischen Dekonstruktivismus gaben. Das kollidierte natürlich mit der Erwartung des Publikums, doch stehen die Ecken und Kanten, die langen Generalpausen, gerade diesem Werk nicht schlecht. Originelle Orchestrierungseinfälle wie ein Duett von Flöte und Trompete sind erlebbar.
Fazit: Mit Rossinis Elisabetta hat das Theater an der Wien hat auf dem Acker der musikalischen Raritäten ein Werk ausgegraben, das eher Kartoffel als Trüffel ist, aber ordentlich zubereitet durchaus zum Ohrenschmaus taugt.