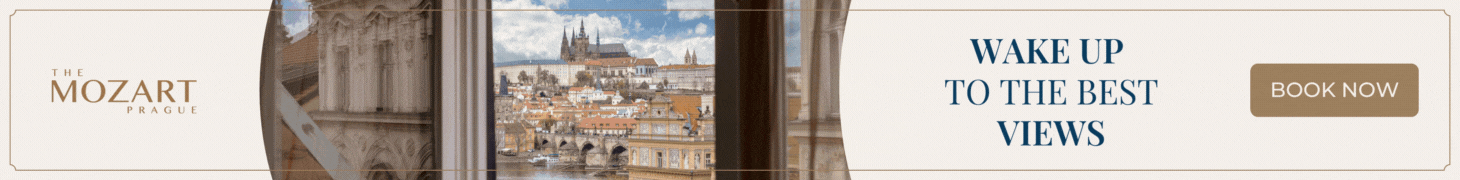Händel geht immer – das erlebte ich 2010 in einer lauen Sommernacht auf der Burgruine Reinsberg, wo ich Aug in Aug mit den Protagonisten von Acis und Galatea saß, die auf jenem Rasen sangen und spielten, der gleichzeitig das Parkett bildete. Das funktioniert auch auf der Riesenbühne der Metropolitan Opera, seit Marylin Horne 1984 als Rinaldo das Schwert in die Hand nahm. Die Wiener Staatsoper überließ den Komponisten bislang dem Theater an der Wien, welches mit dem jüngst gezeigten Saul einen Reifegrad in diesem Repertoire sehen ließ, der fast schon überwältigend ist. Aber Konkurrenz belebt das Geschäft, man lernt auch davon, und so wagte sich die Staatsoper nach der zauberhaften Alcina aus 2010 an ein zweites Händel-Experiment.
Doch warum gerade Ariodante? Wollte man den guten Wind aus Christof Loys Salzburger Produktion mit Cecilia Bartoli als Ritter Conchita nützen? Um neues Publikum mit Händel zu gewinnen, gibt es allerdings Werke, die zugänglicher sind als die gut vierstündige Liebesgeschichte zwischen der Schottenprinzessin Ginevra und dem Rittersmann Orlando, die zerbrochen scheint, als die Kammerzofe Dalinda aus verhängnisvoller Schwärmerei für Orlandos Rivalen Polinesso bei einer Intrige mitspielt, die ihre Herrin kompromittiert und Polinesso schließlich das Leben kostet. Vielleicht wollte man aber auch ganz bewusst auf Superhits wie Rinaldo oder Giulio Cesare verzichten, weil das dafür notwendige koloraturversierte Bühnenpersonal noch schwieriger zu beschaffen ist als für Ariodante. Dieser Gedanke drängt sich auf, denn gut die Hälfte der Besetzung blieb trotz bestens belegter Erfahrung in diesem Repertoire zumindest am Premierenabend weit unter den Erwartungen.
Regisseur David McVicar wird mit seiner vierten Arbeit für die Wiener Staatsoper endlich seinem Ruf gerecht, den er sich an anderen Häusern (etwa an der Met mit Giulio Cesare) erworben hat. Mit Tristan und Isolde, Falstaff und Adriana Lecouvreur ist er bislang unter seinen Möglichkeiten geblieben, zeigt hier aber in der Ausstattung von Vicki Mortimer barocken Aufwand, ohne altmodisch zu wirken: Bewegliche steinerne Wände, eine Bibliothek, ein von Schneeflocken berieselter Strand, dazwischen von Colm Seery gefällig choreographierte Auftritte und Ballette in Kostümen, die man als modern interpretiertes Rokoko mit Zitaten aus dem Mittelalter und Schottenkaros charakterisieren könnte – das hat Flair, auch wenn nicht nur Veganer auf den von der Decke baumelnden Hirsch-Kadaver gern verzichten würden.
Auffallend positiv war Countertenor Christophe Dumaux, der dem Polinesso ein diabolisches Profil verlieh und mit Stimmkraft und präziser Intonierung punktete. Als Ginevra überraschte Ensemblemitglied Chen Reiss. Dass sie eine sehr wandelbare Sängerin ist, hat sie in den verschiedensten Partien an diesem Haus schon bewiesen, aber dass sie sich mit Händels Stil so überzeugend angefreundet hat und auch in einer anspruchsvollen Choreographie ihre Sicherheit nicht verliert, ist mehr als erfreulich. Ihre Ensemble-Kollegin Hila Fahima gab Dalinda mit jugendlich-frischer Stimme und schönen Koloraturen; ein wenig Arbeit sollte noch darauf verwendet werden, diese treffsicherer in Spitzentöne münden zu lassen.
Wenig Schönklang in der Höhe war leider noch das geringste Problem von Sarah Connolly in der Titelpartie, die sich mit der Koloratur extrem mühte und teilweise ins kaum Hörbare verschliff. Immerhin machte sie sich als subtile musikalische Gestalterin bemerkbar. Wilhelm Schwinghammer als Ginevras Vater und König von Schottland zeigte ebenfalls nicht die geforderte „geläufige Gurgel“, die man auch als Bass für Händel braucht; im Verbund mit eigenartiger Perücke samt Halbglatze rückte seine Vorstellung schon in die Nähe der Parodie. Dagegen fiel Rainer Trost mit einer für seine Verhältnisse bloß durchschnittlichen Leistung noch positiv auf.
Die musikalische Leistung lag in den bewährten Händen von William Christie, dessen Glyndebourne Theodora in der Regie von Peter Sellars 1996 bis heute zum Intensivsten gehört, das jemals auf einer Musikbühne zu geboten wurde. Auch an diesem Abend fehlte es nicht an Qualität, doch gestaltete sich das Dirigat weitgehend vorhersehbar, und die berühmte Strahlkraft seines Originalklangensembles Les Arts Florissants wollte sich zumindest im hinteren Teil des Parketts kaum entfalten. Insgesamt entstand über weite Strecken der Eindruck von Händel extra dry, wo man sich Süffiges mit langem Abgang erwartet hatte. Besonders überraschend war, dass der als sängerfreundlich bekannte Christie für „Scherza infida“ ein breit ausladendes Tempo anschlug, das zwar korrekt war, aber Sarah Connolly zum Atmen an Stellen zwang, wo dies nicht geboten ist. Nichtsdestotrotz war diese intime Darstellung des Liebeskummers, die quälende Fantasie von der Geliebten in den Armen ihres Neuen, der Höhepunkt des Abends. Der Gustav Mahler Chor erledigte hingegen seine Sache zur vollsten Zufriedenheit.
Im Gegensatz zu etlichem, was das oben Gesagte erwarten ließe, wurde der Abend vom Publikum ausgiebig bejubelt. Für nicht wenige im Publikum war dies die allererste Erfahrung mit Händel-Oper abseits Cecilia Bartoli-Liederabenden, und der Zauber von Händels Musik wirkt immer noch. Das bestätigt auch die Sinnhaftigkeit des Vorhabens, auch als großes Haus mit alter Musik neues Publikum zu gewinnen.