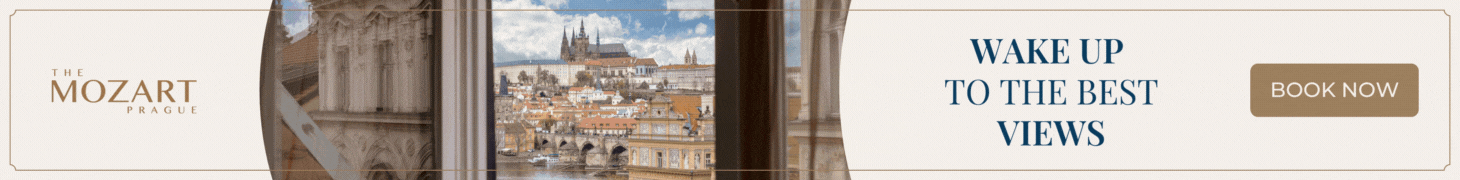Wohl noch nie habe ich so erleichtert aufgeatmet, als Mimìs Hand endlich erschlafft aus dem Muff gefallen war. Oder anders gesagt, wenn Collines Mantelarie in gesanglicher Hinsicht zum emotionalen Höhepunkt von Giacomo Puccinis La bohème wird, läuft etwas gewaltig schief. In Franco Zeffirellis Inszenierung an der Wiener Staatsoper, die außer repertoiretauglich, nach mittlerweile über 400 Aufführungen, auch schon ziemlich angestaubt ist, mühte sich das Sängerensemble mit unterschiedlichem Erfolg durch den Abend.
Jean-François Borras hatte ich von vergangenen Vorstellungen in Graz und Wien in sehr guter Erinnerung, seine Stimme hat sich aber scheinbar in eine Richtung entwickelt, die den Rodolfo zu einer Zitterpartie werden ließ. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn obgleich das Timbre immer noch angenehm weich und karamellig schimmernd ist, hat sich ein störendes Vibrato eingeschlichen, das besonders jeden Versuch eines Legatobogens ins Wanken brachte. Zusätzlich hatte er immer wieder mit der Höhe und den Pianiphrasen zu kämpfen, die er fallweise gleich umschiffte (etwa am Schluss des ersten Akts) oder ins Falsett zu retten versuchte. Schade, dass die Stimme den sichtlich um eine differenzierte Gestaltung bemühten Tenor über weite Teile des Abends so im Stich ließ, denn hin und wieder blitzte doch wieder die frühere vokale Leichtigkeit durch, derer man sich mehr gewünscht hätte.
Ebenso nicht ganz unproblematisch war die Mimì von Anita Hartig. Teils setzte sie ihren Sopran wunderbar aufblühend ein und klang so rein und pur, wie sich Puccini seine Heldin wohl idealisiert hatte. Dann wiederum gerieten Spitzentöne scharf und hart. Das gleiche Problem der Unausgewogenheit stellte ihre dynamische Gestaltung dar. So pendelte sie zwischen üppig tönenden, verschwenderischen Phrasen einerseits und extrem zurückhaltenden, beinahe unhörbaren, Passagen, in denen die Stimme sehr müde wirkte, andererseits. Sowohl Borras als auch Hartig ließen überdies in ihrer stimmlichen Gestaltung die Emotionen bestenfalls auf Sparflamme köcheln und wirkten distanziert; ein Eindruck, der sich auch in der darstellerischen Interaktion der beiden fortsetzte.
Seinen Bariton angenehm strömen lassen konnte Orhan Yildiz’ Marcello vor allem in den sanfteren Momenten, beispielsweise im Duett mit Rodolfo im vierten Akt, jedoch ließ er sich in Ensembleszenen zum Forcieren verleiten, was die Stimme sämtlicher Schönheit beraubte. Für einige kokette Farbtupfer und schöne Höhen sorgte Valentina Nafornita als kapriziöse, dennoch nicht übertriebene, Musetta. Leider hat die Stimme aber schon in der Mittellage häufig nicht mehr die nötige Substanz, um problemlos über das Orchester zu kommen, im Gegensatz zu Yildiz ließ sich Nafornita dadurch aber immerhin nicht zu ungesundem Nachdrücken verleiten. Wie beim Hauptpaar des Abends war auch die Interaktion zwischen Marcello und Musetta stark zurückgeschraubt – ich habe definitiv noch nie einen so leidenschaftslosen Schlagabtausch am Schluss des dritten Akts erlebt, wie hier. Jongmin Park lieferte, wie schon eingangs erwähnt, in einer ehrlich berührenden Mantelarie mit seinem sonoren Bass zumindest einen kurzen sängerischen Glücksmoment.
Sein WG-Kollege Schaunard, verkörpert von Igor Onishchenko, blieb hingegen sehr oft praktisch unhörbar und insgesamt unauffällig. Enttäuschend war leider auch der Kinderchor, was angesichts der Tatsache, dass es eben Kinder und (noch) keine Profis sind, natürlich anders zu bewerten ist, als der ebenfalls meist unpräzise einsetzende Chor der Wiener Staatsoper. Insgesamt – ich kann es leider nicht anders sagen – war das, was man auf der Bühne zu sehen und hören bekam, schlichtweg enttäuschend. Besonders gemessen daran, dass man sich vom Haus am Ring bei einem solchen Repertoire-Klassiker ein höheres Niveau durchaus erwarten darf.
Gänzlich konträr war hingegen das, was sich im Orchestergraben abspielte, denn dort tat sich regelrecht ein emotionales Paralleluniversum auf. Unter dem Dirigat von Speranza Scappucci tönte feurige Italianità in großzügig glänzenden Klangfarben und all die Emotionen, die auf der Bühne fehlten, wurden vom Orchester der Wiener Staatsoper feinsinnig ausgebreitet. Es wirkte fast so, als seien sämtliche Beteiligten im Orchestergraben die einzigen, die bei dieser Vorstellung wirklich aus vollem Herzen dabei waren. So ließen die Musiker etwa die überschwängliche Lebensfreude des Quartier Latin im zweiten Akt vielschichtig und farbstrahlend Funken sprühen und die Verzweiflung des finalen Akts gelang so wunderbar herzerweichend, besonders das kurze Intermezzo vor dem „Sono andati?”, dass sich doch noch eine kleine Träne in meine Augen verirrte.
Bei manchen Vorstellungen fällt eine abschließende Bewertung in Sternen leicht, diese La bohème gehört nun wirklich nicht dazu. Speranza Scappucci und das Staatsopernorchester, die mit einer hervorragenden Umsetzung von Puccinis Musik gleichzeitig rettendes Element und echtes Highlight der Vorstellung waren, hätten sich definitiv eine bessere Wertung verdient. Angesichts der enttäuschenden Sänger hinterließ der Abend jedoch vor allem einen schalen Nachgeschmack.