Hamburg, Staatsoper Hamburg, CARMEN - Georges Bizet, IOCO Kritik, 20.09.2022



CARMEN - Georges Bizet
- Knallbunter Klamauk mit Musikbegleitung -
von Christian Biskup

Georges Bizets Carmen gehört zu den bekanntesten und beliebtesten Stücke des Opernkanons und es würde wohl niemanden wundern, wenn alle IOCO Korrespondenten nicht auch die verschiedensten Carmen - Ausführungen in großer Zahl besucht hätten. Auch für den Rezensenten der Hamburger Premiere am 17. September 2022 gehört Carmen zu den Werken, die schon seit Kindesbeinen heißgeliebt wurden und auswendig mitgesungen werden können. Umso schwieriger ist es, den Erwartungen zu entsprechen – so auch in Hamburg, wo die Aufführung vollkommen versagte.
Wenn ich an meine erste – meiner Meinung nach wie vor unerreichte – Carmen, Maria Ewing, denke, sind die Klänge, die Phrasengestaltung, die Personenführung stets präsent. Das heißt nicht, dass ich mich nicht auf andere Ausführungen einlassen könnte - im Gegenteil. Erst vor wenigen Jahren erlebte ich eine tolle Carmen in Lüneburg, ebenso in Braunschweig. Es war ungemein spannend, die Ansätze zu vergleichen, abzuwägen, infrage zu stellen. Und am Ende kam ich beglückt aus dem Opernhaus, obwohl dies ja nicht Häuser sind, unter denen man üblicherweise die bedeutendsten Bühnen versteht. Was jedoch zum Beginn der Spielzeit 2022/23 auf die Bühne des renommierten Hamburger Hauses gelangte, ist fast schon eine Frechheit – gegenüber dem Werk und gegenüber dem Publikum.

Die Handlung von Carmen ist sicherlich weitgehend bekannt. Ob man sie tiefenpsychologisch ausleuchtet, schlicht erzählt oder aus der beliebten Sicht des inhaftierten Don Josés erzählt, bleibt jedem überlassen. Aber dem Werk an der Staatsoper Hamburg derart oberflächlich und ohne eine gewisse Ernsthaftigkeit zu begegnen, habe ich nicht erwartet.
Sobald sich die Bühne öffnet, steht ein knallbunter Klamaukhaufen parat, der lächerliche Gesten über sich ergehen lassen muss. Sobald sich die Musik in einen flotten 2/4- oder 4/4-Takt begibt, werden die Arme in Volksfestmanier geschwungen, in den Chorszenen dazu ohne Sinn und Verstand rumgeblödelt. In den intimeren Stellen verfällt die Darstellung in ein bloßes Rampensingen. Personenführung? – Fehlanzeige. Schon nach wenigen Minuten wusste ich es: Die Parade der Zinnsoldaten. Anders konnte ich mir die knalligen Offizierskostüme im Nussknackerstil mit ihren teils roboterhaften Bewegungen nicht erklären. Die Handlung, die reizvollen Personenkonstellationen - man denke an das herrliche Schmugglerquintett – werden einfach verschenkt. Requisiten gibt es dabei ebenfalls kaum. Der Brief der Mutter an Jose, Zigaretten, Stühle - alles wird gestisch auf dem Niveau einer Grundschulklasse angedeutet. Den Sängerinnen und Sängern kann man es nicht verdenken, dass sie nicht schauspielern konnten - es gab schlichtweg keine ernsthafte Gelegenheit.
Trotz all dem Klamauk und jecken Karnevalstreiben kann man nicht abstreiten, dass die Inszenierung von Herbert Fritsch irgendwie funktionierte. Obwohl Dialoge umgedichtet, auch einige Striche vorgenommen wurden, war die Handlung doch nachvollziehbar...wenn auch auf einem Niveau, das einem Haus ersten Ranges nicht würdig ist. Doch das ist auch längst nicht das Hauptproblem dieser Produktion. Das sitzt nämlich im Orchestergraben und ist zweifellos das Dirigat von Yoel Gamzou. Bereits das Prelude ließ Böses erahnen, hörte man doch die Anfangstakte noch nie so rasant wie an diesem Abend. Das allein macht die Sache an sich nicht schlecht. Wenn jedoch dann die Zwischenteile plötzlich etwa auf der Hälfte des Tempos genommen werden, zerfällt das ganze Stück ins Bausteinhafte, was sich durch den ganzen Abend zieht. Kaum ein Tempo stimmt. Entweder werden die herrlichen Nummern verschleppt oder derart überschnell genommen, dass man von einer Karikatur ausgehen müsste. Phrasenenden kostet Gamzou dermaßen aus, dass jeglicher natürlicher Fluss - der dieser Musik wie kaum einer anderen innewohnt - versiegt. Die Partitur verkommt zu einem artifiziellen Machwerk mit unlogischen Tempi. Bei den zahlreichen Rubati, nicht notierten Generalpausen und verkünstelt ausdirigierte Phrasen meint man, einen veristischen Puccini zu hören.
Bizet, französisches Flair und natürliche Eleganz sind für den Dirigenten scheinbar Störfaktoren. Dies rächt sich natürlich auch im Ensemblespiel. Die Chöre – besonders der Kinderchor – driften in Extremen auseinander, dass man teilweise fast einen ganzen Takt hinter dem Orchester ist. Dieses wiederum folgt dem Dirigenten sehr präzise - was in dem Fall durchaus kritisch zu sehen ist. Warum wagte es niemand im Orchester, dieser Fehlinterpretation zu widersprechen? Es trägt letztlich die Mitschuld an der völlig missratenen musikalischen Darbietung, die wohl nur den Zweck hatte, der wild herumwirbelnden One-Man-Show im Graben zu dienen. Ich habe schon Orchester erlebt, die wegen der Änderung eines Bogenstrichs Debatten mit dem musikalischen Leiter anfingen. Dabei hätte die Aufführung, gemessen an der Leistung der Solisten, zumindest solide werden können.

Maria Kataeva in der Rolle der Carmen war eine gute Besetzungswahl. Mit ihrer glühenden Höhe und angenehm dunklen Tiefe gab sie ein musikalisch gelungenes Rollenporträt, das besonders in der verspielten Arie um ihren Freund Lillas Pastias viel Freude machte. Mit der zu schnell genommenen Habanera konnte sie nicht punkten – weder ließ der Dirigent Zeit zum Atmen noch zur Darbietung der lasziven Erotik. Höhepunkt ihrer Partie war das Tanzlied in der Schenke, wobei sie selber die Kastagnetten in solch einer Perfektion erklingen ließ, wie ich es noch nie erlebt habe. Neben ihr fiel Tomislav Mužek als Don José doch etwas herab. Mužek verfügt über einen prachtvollen lyrischen Tenor. Purer Schönklang, mühelose Spitzentöne und eine hervorragende Diktion prägen seine Darbietung. Ein Don José ist er dennoch nicht, es fehlt an jeglicher Expressivität. Egal ob er von seiner Mutter singt, in glühender Leidenschaft erbebt oder als Soldat wirkt – es klingt alles gleich. Deutlich schwach zeigt sich Kostas Smoriginas als Escamillo, der die Rolle des Scarpia mit Escamillo verwechselt und sich ungemein voluminös, unkultiviert, fast schon gewaltsam durch die Partie singt. Auch das restliche Ensemble trägt nicht unbedingt zur Freude bei. Morales und Zuniga, aber auch die Schmugglerbande wenig beglückend. Für die Sternstunde sorgte die Michaela der kosovarischen Sopranistin Elbenita Kajtazi. Ein samtig weicher Sopran, strahlend klar und rein – könnte er für die Rolle idealer sein? Das große Duett im ersten Akt wird der Höhepunkt des Abends. Da stimmt einfach jede Phrase, jede Emotion (und sogar fast jedes Tempo...) und erhält mit Recht einen langen Szenenapplaus.
Das Publikum ist am Ende der Vorstellung hin- und hergerissen. Die einen sind begeistert, es sind aber auch beachtlich viele Buh-Rufe für Regie und Dirigat zu vernehmen. Es hält sich ja nach wie vor die Mär, dass Bizet aufgrund des Misserfolgs (der ja musikwissenschaftlich auch widerlegt ist) der Uraufführung aus Kummer gestorben sei. Hier in Hamburg hätte es ihn sicher schon während der ersten beiden Akte dahingerafft. Wie das Publikum zum Narren gehalten wird, ist unerträglich, zumal auch viele Übertitel schlichtweg falsch übersetzt und dargestellt sind. Und dennoch - kaum trat ich aus dem Opernhaus, klebte ein Ohrwurm nach dem anderen auf meinen Lippen. Man kann beruhigt sein - selbst solch ein Zinnfigurentheater kriegt Bizet nicht unter – seine Musik wird immer überleben. Der Inszenierung an der Staatsoper Hamburg wird es garantiert nicht so gehen.
---| IOCO Kritik Staatsoper Hamburg |---

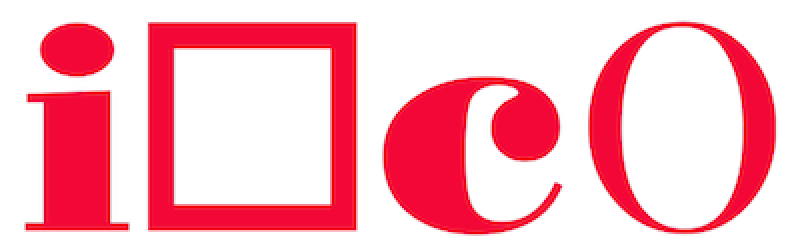

Kommentare ()